Teilprojekte
- Querschnittsdimensionen
PROJEKTBESCHREIBUNG
Das Projekt "Von
der Agrarwende zur Konsumwende?" untersucht, inwieweit
die Agrarwende von einer entsprechenden Veränderung des Ernährungsverhaltens
der Konsumenten gestützt wird, welche Faktoren diesen Zusammenhang
beeinflussen und wie er optimiert werden kann.
Zu diesem Zweck untersucht es die Effekte der im Rahmen der Agrarwende
ergriffenen Maßnahmen entlang der Akteurskette (Erzeugung, Verarbeitung,
Handel, Ernährungsberatung, Verbraucher), bewertet sie unter dem
Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und erarbeitet entsprechende Gestaltungsempfehlungen
zur Überwindung der identifizierten Hemmnisse.
Empirisch stützt sich das Projekt auf regionale und großstädtische
Fallstudien sowie auf bundesweite Erhebungen.
Organisatorisch wird es durch fünf akteursspezifische Teilprojekte,
vier Quer-schnittsdimensionen (theoretisches Rahmenkonzept, regional
spezifizierte Kriterien nachhaltigen Konsums, Brückenkonzepte auf
der Akteursebene, Genderaspekte im Feld der Agrar- und Konsumwende)
und sieben Integrations-workshops verzahnt. Die Koordination des Gesamtprojekts
liegt bei der MPS.
Das Projekt wird vom BMBF
gefördert und läuft seit dem 1.11.2002 bis zum 31.10.2005.
Geplant sind Veröffentlichungen und Akteursempfehlungen zur
Optimierung der Verknüpfung von Agrar- und Konsumwende.
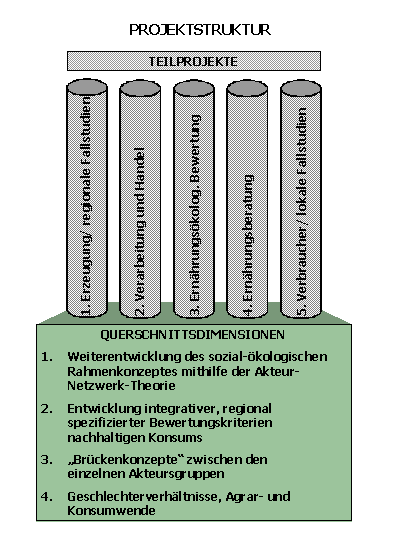
nach
oben
TEILPROJEKTE
TP1
- TP2 - TP3 - TP4
- TP5
Teilprojekt
1: Erzeugung
Bewertungskriterien und Entwicklungsszenarien für eine
nachhaltige Nahrungserzeugung - regionale Fallstudien
Zielsetzung von Teilprojekt 1 ist es, die Auswirkungen der Agrarwende
auf Erzeugerebene zu untersuchen und diese unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten
zu bewerten. Daraus sollen Handlungsempfehlungen für Politik und
Wissenschaft im Hinblick auf die Unterstützung nachhaltiger Produktionsweisen
abgeleitet werden.
Im Mittelpunkt steht dabei die Erstellung regionaler Fallstudien in
Bayern und Mecklenburg-Vorpommern, zwei Regionen mit relativ hohem Anteil
an ökologischem Landbau, jedoch sehr unterschiedlichen Agrarstrukturen
und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Diese Kontrastregionen wurden
bewusst gewählt, um unterschiedliche Entwicklungstendenzen verdeutlichen
zu können.
Ausgehend von dem Ziel der Agrarwende, die Landwirtschaft in Deutschland
nachhaltiger zu gestalten und dafür die ökologisch bewirtschaftete
Fläche auf 20 % auszudehnen, ergeben sich die folgenden Forschungsfragen:
• Welche Faktoren bestimmen die Bereitschaft der Landwirte, auf
ökologischen Landbau umzustellen?
• Welche Effekte der Agrarwende im Hinblick auf die Umstellungsbereitschaft
und
-motivation lassen sich feststellen?
• Welche Entwicklungstendenzen/ -szenarien lassen sich daraus
ableiten?
• Wie sehen Optimierungsstrategien im Hinblick auf eine „nachhaltige
Umstellungsmotivation“ aus, um zu gewährleisten, dass die
Ausweitung des Öko-Landbaus nicht nur quantitativ erfolgt, sondern
auch Nachhaltigkeitskriterien entspricht.
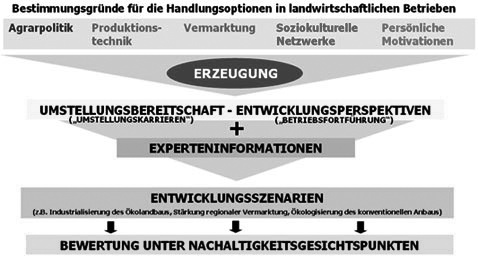
Aufgrund der überragenden Bedeutung, die die Bereitschaft von Landwirten
auf Öko-Landbau umzustellen für dessen Entwicklungspotential
spielt, wurde dieser Aspekt in den Mittelpunkt der Untersuchung gestellt.
Von besonderem Interesse erscheint hierbei wiederum der Zusammenhang
zwischen persönlicher Motivation und soziokulturellen Netzwerken,
da dieser bisher kaum untersucht wurde.
Hinsichtlich der Bewertungskriterien für eine regionale und nachhaltige
Nahrungsproduktion besteht der größte Mangel im Bereich der
sozialen Dimension. Als konsequente Umsetzung dieser Erkenntnis steht
dies im Mittelpunkt der empirischen Untersuchungen.
nach
oben
Teilprojekt
2: Verarbeitung und Handel
Nachhaltige Agrarpolitik und Unternehmensstrategien:
zur Rezeption politischer Steuerungsimpulse auf betriebswirtschaftlicher
Ebene
Zentrale Fragestellung
ist die Wahrnehmung der Agrarwende durch Verarbeitungs- und Handelsunternehmen
und die daraus resultierenden Marketingstrategien.
Ziel ist es, durch Identifikation von Einflussfaktoren auf die jeweilige
Strategiewahl der Unternehmen aufzuzeigen, welche Einflussmöglichkeiten
und Steuerungsmechanismen bestehen, um zu einer Ausweitung der Konsumwende
beizutragen.
nach
oben
Teilprojekt
3: Ernährungsökologische Bewertung
Ernährungsökologische Bewertung von stark verarbeitetenÖko-Lebensmittel
(Öko-Convenience-Produkte)
Es wird eine Bewertung von stark verarbeiteten Öko-Lebensmitteln
entsprechend den Kriterien der Ernährungsökologie bezüglich
ihrer gesundheitlichen, ökologischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Effekte vorgenommen.
Hintergrund
In der aktuellen
Konsumentenforschung wird die zunehmende Convenience-Orientierung von
VerbraucherInnen - auch im Ökobereich - als wesentlicher Trend
beschrieben, der durch soziodemographische Entwicklungen (z. B. steigende
Erwerbstätigkeit von Frauen) und Zeitgewinn für die Freizeit
gestützt wird. Folglich stellen sich Fragen nach einer umfassenden
Bewertung von stark verarbeiteten Öko-Produkten, beispielsweise
bezüglich Zutaten, Zusatz- und Hilfsstoffen, sowie technologischer
Herstellungs- und Verarbeitungsverfahren, bis hin zu Fragen der Verpackung.
Mit zunehmender Verarbeitungsintensität können z.B. aufgrund
verstärkter Verarbeitungsschritte, vermehrter Transporte sowie
aufwändigerer Verpackungen die ökologischen Belastungen steigen.
Durch neu entstehende Arbeitsplätze oder z.B. regionale Wertschöpfung
hat die Lebensmittelverarbeitung auch gesellschaftliche und ökonomische
Auswirkungen.
Geplante Vorgehensweise
Die Bewertung
der Verarbeitung von Öko-Lebensmitteln wird auf den vier Ebenen
der Ernährungsökologie (Gesundheit, Umwelt, Gesellschaft und
Wirtschaft) vorgenommen. Für diese Ebenen ergeben sich folgende
mögliche Fragestellungen:
Auf
der Ebene Gesundheit wird das Herstellungsverfahren
bzw. das Endprodukt untersucht.
- Wie sind die ausgewählten Lebensmittel bezüglich einer ausreichenden
Zufuhr essentieller Nährstoffe, einer minimalen Zufuhr von Risikofaktoren
bzw. einer Prävention von ernährungsabhängigen Erkrankungen
zu bewerten?
Auf der Ebene
Umwelt werden die Auswirkungen des Herstellungsverfahrens
bzw. des Endprodukts auf verschiedene ausgewählte Umweltaspekte
betrachtet.
- Welche Umweltwirkungen haben die eingesetzten Technologien?
- Welcher Umweltverbrauch ist mit dem Produkt verbunden?
Auf
der Ebene Gesellschaft werden die Effekte
des Herstellungsverfahrens bzw. des Endprodukts mit Fokus auf Dritte
betrachtet. Mögliche Aspekte sind:
- Beziehen die Hersteller von Öko-Convenience-Lebensmitteln Zutaten
aus Fairem Handel oder aus sozialen Einrichtungen?
- Setzen sich die Hersteller für die Umsetzung sozialer Aspekte
in ihrem Unternehmen ein (z.B. Gesundheitsschutz, Kindertagesstätten,...)?
Es
werden wirtschaftliche Auswirkungen der Herstellung von hochverarbeiteten
Öko-Lebensmitteln auf das Unternehmen, die Region oder auf Dritte
untersucht.
- Werden durch die Herstellung Arbeitsplätze geschaffen?
- Welche Wertschöpfung kann durch diese Produkte erzielt werden
?
- Welche ökonomischen Effekte hat die Verarbeitung auf die Region?
nach
oben
Teilprojekt
4: Ernährungsberatung
Innovative Ansätze für die Ernährungsberatung
Ziel von Teilprojekt 4 ist es,
Handlungsoptionen für die Ernährungsberatung zu entwickeln,
um eine nachhaltige Ernährungsweise bei der Bevölkerung zu
fördern. Dabei sollen insbesondere neue, innovative Wege der Verbraucherberatung
aufgezeigt werden, die sich an den Bedürfnissen, Handlungsmöglichkeiten,
Rationalitäten und Lebensstilen der geschlechts-, alters- und milieuspezifischen
Zielgruppen orientieren.
Ausgangspunkt dieses Teils des Forschungsvorhabens bildet eine Bestandsaufnahme
der Beratungsangebote mit Blick auf die Förderung nachhaltiger
Ernährungsmuster. Gegenstand der Erhebung sind Institutionen und
Initiativen in Deutschland, Bayern und München, die Ernährungsinformationen
anbieten.
Das zu untersuchende Angebot wird hinsichtlich der angesprochenen Zielgruppen,
der inhaltlichen Aussagen bezüglich nachhaltiger Ernährung,
der eingesetzten Kommunikationsformen und der Rahmenbedingungen analysiert.
Dabei stehen mögliche Veränderungen des Angebots im Rahmen
der intendierten Agrar- und Konsumwende im Mittelpunkt.
Ausgehend von den Befunden der Bestandsaufnahme der Ernährungsberatung
und den Untersuchungsergebnissen zum Ernährungs- und Konsumverhalten
der VerbraucherInnen (Teilprojekt 5) sollen in den weiteren Arbeitsschritten
Handlungskonzepte für innovative Beratungsmaßnahmen im Hinblick
auf nachhaltige Ernährungsmuster entwickelt werden. Dabei sollen
im Rahmen unterschiedlicher Entwicklungsszenarien Gestaltungsoptionen
für neue Wege in der Ernährungsberatung aufgezeigt werden.
Da solche Maßnahmen nur erfolgreich sein können, wenn sie
sich an den verschiedenen Bedürfnissen, Handlungsmöglichkeiten,
Rationalitäten und Lebensstilen der geschlechts-, alters- und milieuspezifischen
Zielgruppen orientieren, werden als Optimierungsstrategien nicht primär
generalisierende Maßnahmen, sondern vor allem variable Einzelbausteine
konzipiert, die an die jeweiligen Situationen vor Ort angepasst werden
können (Baukastenprinzip).
Ein konkretes Umsetzungsmodell für die Verbreitung nachhaltiger
Ernährungsmuster ist die interaktive Verbraucherkampagne „futureins
- NRW wird zukunftsfähig“. Diese wird von der Verbraucher-Zentrale
Nordrhein-Westfalen im Auftrag der Landesregierung durchgeführt.
Durch ausgewählte Kommunikationsstrategien und teilweise gezielte
Interventionen auf den Stufen der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung
von Lebensmitteln sollen Aufmerksamkeit für die jeweiligen Themen
und erwünschte Veränderungsprozesse beim Kaufverhalten der
Verbraucher/-innen in Richtung nachhaltige Ernährung ausgelöst
werden.
Auf Grundlage der begleitenden Untersuchung und Bewertung dieser Kampagne
und anderer innovativer Ansätze der Ernährungsberatung soll
daraufhin – in Kooperation mit Praxisvertretern – der Versuch
unternommen werden, sie zu neuen kontext- und zielgruppenspezifischen
Beratungsmodellen zu verknüpfen und geeignete institutionelle Optimierungsstrategien
zu entwickeln.
nach
oben
Teilprojekt
5: VerbraucherInnen
Agrarwende und neue Ernährungsmuster. "Karrieren"
nachhaltigen Konsums - lokale Fallstudien
Im Zentrum der
Analyse stehen Veränderungspotenziale des Ernährungs-verhaltens
auf Verbraucherseite, wie sie sich im Zuge der Agrarwende herauskristallisieren.
Auf der Grundlage von zwei empirischen, großstädtischen Fallstudien
(München und Leipzig) soll geklärt werden, inwieweit die „Agrarwende“
auf Seiten der KonsumentInnen (private Haushalte) eine am Leitbild der
nachhaltigen Entwicklung orientierte Veränderung des Ernährungsverhaltens
und –handelns bewirkt. Dabei sollen typische "nachhaltige
Ernährungskarrieren" identifiziert werden, die die Möglichkeiten
bieten, Anknüpfungspunkte und Optimierungsstrategien für eine
Konsumwende zu entwickeln (Weitere Infos auf MPS-Homepage: Projekt
Agrarwende nähere Beschreibung/Verlauf von Modul 5).
In qualitativen und quantitativen Befragungen werden sowohl hemmende
Faktoren wie positive Anknüpfungspunkte herausgearbeitet. Das betrifft
einerseits Aspekte des Ernährungswissens, der Wahrnehmung und Bewertung
der „Agrarwende“, die Verknüpfung von Zielen der Agrarwende
mit subjektiven Qualitätskriterien und symbolische Strategien der
Herstellung von Sicherheits-Fiktionen. Das betrifft andererseits die
Einbettung des Ernährungsverhaltens in alltägliche Formen
der Lebensführung, seine Verknüpfung mit Symbolisierungs-
und Distinktionsaspekten – oder auch mit biographischen Wendepunkten
(Schwangerschaft und Geburt von Kindern, Krankheiten, Aufnahme von Partnerschaften/Haushaltsgründung,
„viertes Alter“/Ruhestand“ etc.), aber auch die Wahrnehmung
von strukturellen Faktoren wie Angebotsstruktur, Preisrelationen, Haushaltsökonomie
etc.. Gestützt auf die empirischen Befunde sollen dann –
z.T. in Kooperation mit Institutionen der Verbraucherberatung –
mit Hilfe von Fokusgruppendiskussionen unterschiedliche Szenarien für
praktische Anknüpfungspunkte einer Ernährungs- und Konsumwende
entwickelt werden.
Nähere
Forschungsziele:
• Aufarbeitung der Forschung zur Strukturierung von Ernährungsmustern,
insbesondere mit Blick auf alltagsweltliche und geschlechtsspezifische
Prägungen, den strukturellen Kontext von Konsumtrends und Formen
des alltagsweltlichen Umgangs mit ernährungsbezogenen Risikodiskursen
(BSE etc.),
• Analyse der Effekte (auch der nicht-intendierten Folgen) und
Handlungs-möglichkeiten, welche im Kontext der Agrarwende auf Seiten
der KonsumentInnen entstehen,
• nähere Herausarbeitung der Anknüpfungspunkte und hemmenden
Faktoren auf der Wahrnehmungsebene (Wissen und Einschätzung der
Agrarwende), Handlungsebene (bisher erfolgte Ernährungsumstellungen)
und Strukturebene (weiterhin bestehende Hemmnisse und deren Abbau),
• die Erforschung von sich entwickelnden "Karrieren nachhaltigen
Konsums" in Ernährungsfragen sowie die Eruierung von Transformationsprozessen
auf der biographisch-individuellen Ebene,
• Identifikation von Gestaltungsmöglichkeiten und strukturellen
Hemmnissen für eine am Leitbild der Nachhaltigkeit orientierte
Transformation des Ernährungsverhaltens;
• in Kooperation mit den anderen Projektpartnern Erarbeitung von
Optimierungsvorschlägen für eine Stärkung sozial-ökologischer
Transformation im Ernährungsbereich und die Erschließung
neuer KonsumentInnen-Gruppen – auch für die Verbraucherberatung.
• Zusätzlich sollen in Kooperation mit den anderen Arbeitspaketen
die sich wandelnden Ziele, Interessen, Motivationen, Stabilisierungen
und Barrieren für eine Verknüpfung von Agrar- und Konsumwende
über die Akteurskette hinweg herausgearbeitet werden.
nach
oben
QUERSCHNITTSDIMENSIONEN
Querschnittsdimension
1
Weiterentwicklung des sozial-ökologischen Rahmenkonzepts
mithilfe der Akteur-Netzwerk-Theorie
Mithilfe der Akteur-Netzwerk-Theorie werden die im Rahmen der Agrarwende
stattfindenden Transformationen bestehender Akteurskonstellationen analysiert.
Damit wird zugleich eine konzeptionelle Vertiefung des Rahmenkonzepts
der sozial-ökologischen Forschung angestrebt.
Querschnittsdimension
2
Entwicklung integrativer, regional spezifizierter
Bewertungskriterien nachhaltigen Konsums
Die quantitative Ausweitung des Ökolandbaus oder auch die regionale
Vermarktung sind nicht per se schon nachhaltig. Es bedarf vielmehr einer
regional differenzierten Analyse, um entsprechende Nachhaltigkeitskriterien
zu entwickeln. Das geschieht parallel zum Fortgang des Projekts durch
die Verknüpfung verschiedener fachlicher Perspektiven und Teilergebnisse.
Querschnittsdimension
3
„Brückenkonzepte“ zwischen den einzelnen
Akteursgruppen
Hier steht die Analyse von alltagsweltlichen Brückenkonzepten,
d. h. von Begriffen, Metaphern, Symbolen und Bildern im Vordergrund,
die die Kommunikation zwischen den Akteursgruppen steuern. Ausgangspunkt
ist die These, dass die intendierte Agrarwende nur dann durch eine Konsumwende
gestützt wird, wenn sich auch neue Brückenkonzepte einer nachhaltigen
Produktionsform von Lebensmitteln durchsetzen.
Querschnittsdimension
4
Geschlechterverhältnisse, Agrar- und Konsumwende
Es werden die zugrunde liegenden Geschlechterverhältnisse untersucht,
welche die Chancen mitbestimmen, von der politisch initiierten „Agrarwende“
zu einer auch kulturellen „Konsumwende“ zu gelangen. So
treten Frauen an allen Punkten der Akteurskette in spezifischer Weise
als kompetente Entscheiderinnen auf. Gleichzeitig schlagen sich Veränderungen
der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte
immer auch in den Geschlechterverhältnissen nieder.
nach
oben
![]()